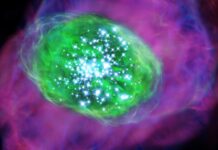Die Elektrokrampftherapie (ECT), eine Behandlung mit induzierten Anfällen zur Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen, kann eine größere Bandbreite an Nebenwirkungen haben als bisher angenommen. Eine neue Studie, die im International Journal of Mental Health veröffentlicht wurde, hat die Debatte über die Praxis neu entfacht und zu Forderungen nach einer vorübergehenden Aussetzung bis zu weiteren Untersuchungen geführt.
Jenseits von Gedächtnisverlust: Ein breiteres Spektrum an Schäden?
Während Kurz- und Langzeitgedächtnisverlust gut dokumentierte Folgen der EKT sind, identifiziert die Forschung 25 weitere besorgniserregende Nebenwirkungen, darunter Herz-Kreislauf-Probleme, anhaltende Müdigkeit und emotionale Abstumpfung. Im Rahmen der Studie wurden 747 ECT-Patienten sowie 201 Verwandte und Freunde befragt, um potenzielle Schäden über die unmittelbaren Folgen der Behandlung hinaus einzuschätzen.
In Großbritannien wird jährlich etwa 2.500 Menschen eine EKT verabreicht, vor allem bei schweren Depressionen, die auf andere Therapien nicht ansprechen, sowie bei Erkrankungen wie Schizophrenie, bipolarer Störung und Katatonie. Bei dem Verfahren werden unter Narkose elektrische Ströme an das Gehirn abgegeben, um Anfälle auszulösen, typischerweise über 6–12 Sitzungen.
Fehlerhafte Recherche, ernste Fragen
Der Autor der Studie, Professor John Read von der University of East London, argumentiert, dass die aktuelle Evidenzbasis nicht ausreicht, um eine fortgesetzte Verwendung zu rechtfertigen. „Angesichts der Tatsache, dass wir immer noch nicht wissen, ob die ECT wirksamer ist als das Placebo, machen es diese überraschenden neuen Erkenntnisse umso dringlicher, sie auszusetzen, bis eine gründliche Untersuchung sowohl der Sicherheit als auch der Wirksamkeit vorliegt“, erklärte er.
Die Untersuchung ergab, dass fast ein Viertel der Teilnehmer (22,9 %) über Herzprobleme wie Herzrhythmusstörungen nach der EKT berichteten, während über die Hälfte (53,9 %) unter wiederkehrenden Kopfschmerzen litt. Drei Viertel (76,4 %) der Patienten berichteten von emotionaler Abstumpfung. Bei einigen Personen kam es auch zu funktionellen Beeinträchtigungen wie Beziehungsschwierigkeiten, Navigationsschwierigkeiten und Verlust des Wortschatzes.
Patientenkonten: Lebensverändernde Folgen
Sue Cunliffe, eine ehemalige EKT-Patientin, beschreibt die Behandlung als „völlig ruiniert mein Leben“. Sie berichtet von anhaltenden Sprachstörungen, Zittern, Gleichgewichtsstörungen und kognitiven Defiziten, die sie daran hindern, als Ärztin zu arbeiten. „Eine Woche vor der ECT saß ich auf einem Laufband, spielte Badminton und konnte Gedichte schreiben, und sechs Wochen später falle ich mit blauen Flecken die Treppe hinunter“, sagte sie.
Geteilte Meinungen unter Fachleuten
ECT bleibt eine polarisierende Behandlung in Kreisen der psychischen Gesundheit. Während einige Ärzte über positive Ergebnisse berichten, bestehen weiterhin Fragen zur Wirksamkeit und zu den langfristigen Auswirkungen. Professorin Tania Gergel, Forschungsleiterin bei Bipolar UK, behauptet, dass es „keine Beweise gibt, die Behauptungen untermauern, dass die moderne EKT ein größeres Risiko für die körperliche Gesundheit birgt oder dass sie langfristige Hirnschäden und eine dauerhafte Verschlechterung der kognitiven Funktionen verursacht.“ Sie betont seinen Nutzen bei der Stabilisierung akuter Symptome und ermöglicht es den Patienten, sich an umfassenderen Genesungsstrategien zu beteiligen.
Professor George Kirov von der Universität Cardiff betont jedoch die „hochwirksame“ Natur der ECT und beobachtete Verbesserungen bei 60 % der Fälle schwerer Depression. Er führt die unzureichende Nutzung im Vereinigten Königreich auf Stigmatisierung zurück und verweist auf die häufigere Nutzung in Nordeuropa. Kirov behauptet, dass Metaanalysen die Überlegenheit der EKT gegenüber Antidepressiva und anderen Interventionen belegen.
Ethische Bedenken und gefährdete Bevölkerungsgruppen
Lucy Johnstone, eine klinische Psychologin, weist auf systemische Probleme im Zusammenhang mit der EKT-Verabreichung hin. Sie betont, dass sich nur wenige Patienten vollständig darüber im Klaren sind, dass das Verfahren weiterhin praktiziert wird und dass ältere Frauen unverhältnismäßig stark betroffen sind und ein Drittel das Verfahren gegen ihren Willen erhält. Sie weist außerdem auf einen besorgniserregenden Zusammenhang zwischen EKT-Einsatz und häuslicher Gewalt bei Patienten hin, was darauf hindeutet, dass die Behandlung manchmal dann eingesetzt wird, wenn andere Interventionen versagen.
Regulatorische Aufsicht und Zukunftsforschung
Die Richtlinien des National Institute for Health and Care Excellence (NICE) beschränken die EKT auf akute, lebensbedrohliche Fälle, Patientenpräferenzen aufgrund früherer Erfahrungen oder behandlungsresistente Situationen. Akkreditierte Kliniken sind verpflichtet, Daten zu Entbindungen und Ergebnissen aufzuzeichnen. Allerdings gibt es weiterhin Forderungen nach einer stärkeren Regulierung und weiterer Forschung zu Langzeiteffekten.
Die Debatte um ECT unterstreicht die Notwendigkeit einer strengen Bewertung sowohl ihrer Vorteile als auch ihrer Risiken, insbesondere angesichts des Potenzials für irreversible Schäden.
Die anhaltende Kontroverse unterstreicht die dringende Notwendigkeit robusterer, placebokontrollierter Studien, um festzustellen, ob die Wirksamkeit der ECT ihre bekannten Nebenwirkungen rechtfertigt.