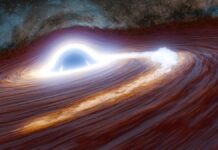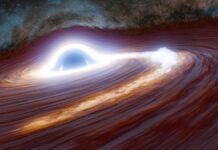Ein neues Buch, „The Arrogant Ape“ der Primatologin Christine Webb, widerlegt den lange gehegten Glauben an den menschlichen Exzeptionalismus und argumentiert, dass diese Ideologie das wissenschaftliche Verständnis verzerrt und den ökologischen Zusammenbruch beschleunigt. Webb behauptet, dass Merkmale, die traditionell zur Rechtfertigung menschlicher Dominanz herangezogen werden – Vernunft, Werkzeuggebrauch, Moral, sogar Schmerzwahrnehmung –, nicht nur für unsere Spezies gelten.
Den Grundglauben in Frage stellen
Webbs Argumentation beruht auf der Beobachtung, dass viele Arten eine komplexe Intelligenz, soziale Bindungen und den Gebrauch von Werkzeugen aufweisen (Krähen, Schimpansen), während andere eine Schmerzempfindlichkeit (Fische, Krebstiere) und kulturelle Übertragung (Bienen) aufweisen. Sie geht davon aus, dass die Idee der menschlichen Vorherrschaft in der religiösen Tradition verwurzelt ist und durch voreingenommene wissenschaftliche Untersuchungen untermauert wird.
Das Buch stellt die darwinistische Vorstellung von der Kontinuität zwischen den Arten in Frage und weist darauf hin, dass das Beharren auf der Einzigartigkeit des Menschen im Widerspruch zur Evolutionsbiologie steht. Webb argumentiert, dass dieser „menschliche Überlegenheitskomplex“ die Forschung auf subtile Weise beeinflusst und Studien über „charismatische“ Säugetiere begünstigt, während er die überwiegende Mehrheit des Lebens auf der Erde außer Acht lässt.
Das Problem mit der Voreingenommenheit
Webb kritisiert die ungleichen Standards für die Intelligenz von Tieren und verweist auf Studien, in denen in Gefangenschaft gehaltene Schimpansen mit autonomen Menschen verglichen werden. Sie betont, dass Laborbeschränkungen das Verhalten und die Funktionsweise von in Gefangenschaft gehaltenen Tieren verzerren und faire Vergleiche unmöglich machen. Ihre eigene Forschung konzentriert sich auf Affen in freier Wildbahn und in Schutzgebieten, wo sie natürlicheres Verhalten und tiefere Zusammenhänge beobachtet.
Der Autor weist darauf hin, dass wahrscheinlich viele nichtmenschliche Wesen über irgendeine Form von Bewusstsein verfügen, was den wissenschaftlichen Widerstand gegen die Anerkennung von Ähnlichkeiten zwischen Arten in Frage stellt. Sie entgegnet dem Vorwurf des Anthropomorphismus und argumentiert, dass das Beharren auf Gewissheit über die Wahrnehmung von Tieren eine Doppelmoral sei: Wir können das Bewusstsein anderer, einschließlich unseres eigenen, niemals wirklich kennen.
Ein Aufruf zur Demut
Der Abbau des menschlichen Exzeptionalismus sei nicht nur eine akademische Übung, argumentiert Webb. Es ist eine Voraussetzung dafür, unseren Platz in der natürlichen Welt zu verstehen und die ökologischen Krisen zu bewältigen, mit denen wir konfrontiert sind. Nur wenn wir uns selbst als Tiere akzeptieren, weder besser noch schlechter als andere, können wir den zerstörerischen Kräften entgegenwirken, die Zoonosenausbrüche, Massensterben und den Klimawandel vorantreiben.
Webb plädiert dafür, die wissenschaftliche Forschung um Erkenntnisse aus indigenen Kulturen zu erweitern, die die einzigartige Vernetzung allen Lebens anerkennen. Sie erkennt an, dass die Herausforderung des menschlichen Exzeptionalismus eine monumentale Aufgabe ist, „der mächtigste unausgesprochene Glaube unserer Zeit“. Sie glaubt jedoch, dass das Verlernen dieser Ideologie die Verbindung zur Natur wiedererwecken und zu einem Eintreten für Tier- und Umweltschutz anregen kann.
In „The Arrogant Ape“ modelliert Webb die Demut, Neugier und das Mitgefühl, die erforderlich sind, um den tief verwurzelten Glauben an die Vorherrschaft des Menschen zu zerstören, und bietet einen radikalen, aber notwendigen Perspektivwechsel